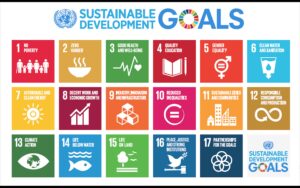Welche Dienstleistungen bietet die Servicestelle?
Die Servicestelle ist das Kompetenzzentrum des Landes für Dialogische Bürgerbeteiligung. Sie berät und begleitet Behörden und unternehmen in kommunaler Hand bei Vorhaben, die einen Bürgerdialog erfordern. Das Team hilft bei der inhaltlichen Planung von Beteiligungsverfahren und begleitet den Dialogprozess vor Ort. Dieser umfassende Service wird vom Land finanziert und den Kommunen kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Außerdem vereinfacht die Vergabeeinheit der Servicestelle die Beauftragung von Moderationsbüros für Bürgerbeteiligungsprozesse. Verwaltungen und öffentliche Unternehmen können aus einem Dienstleisterpool Moderationsbüros beauftragen und müssen nicht selbst ausschreiben.
Mit einem Fördertopf kann die Servicestelle kleine und mittlere Kommunen finanziell unterstützen (unter 20.000 Einwohner*innen).
Wer kann die Servicestelle nutzen?
Unterstützung erhalten können:
- Behörden des Landes, der Kommunen und Landkreise (z.B. Stadtverwaltungen oder Landratsämter)
- Öffentliche Einrichtungen des Landes oder der Kommunen (z.B. Regional- und Zweckverbände, öffentlich-rechtliche Stiftungen)
- Unternehmen in öffentlicher Hand (z.B. Stadtwerke)
- in Einzelfällen auch Bundesbehörden oder -unternehmen, sofern es um ein Vorhaben in Baden-Württemberg geht.
Besonders kleinere Kommunen profitieren von der Servicestelle, da sie oft nicht die Kapazitäten haben, komplexe Beteiligungsprozesse selbst zu stemmen.
Nicht unterstützt werden hingegen Bürgerinitiativen oder zivilgesellschaftliche Gruppen. Für sie ist die Allianz für Beteiligung e.V. die richtige Anlaufstelle. Unseren Artikel dazu findet ihr hier.
Wann ist Dialogische Bürgerbeteiligung sinnvoll?
Dialogische Bürgerbeteiligung eignet sich vor allem, um frühzeitig die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erkennen und bessere, breiter getragene Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist, dass es tatsächlich noch einen Spielraum im Ergebnis gibt. Ansonsten sind Formate für Information und Transparenz besser geeignet.
Typische Beispiele sind umstrittene größere Infrastrukturprojekte oder Bauvorhaben, die Bürger*innen betreffen, wie z.B. neue Windkraftanlagen, Gewerbegebiete oder eine Ortskernsanierung.
Der größte Vorteil ist, dass zufällig ausgewählte und nicht betroffene Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden. Das fördert die Vielfalt der Perspektiven auf die Fragestellung und ermöglicht eine emotionale Distanz zum Vorhaben. Gleichzeitig werden die Zufallsbürgerinnen und -bürger umfassend informiert und haben so eine ausgewogene Entscheidungsgrundlage. Rechtliche Grundlage für die Zufallsauswahl und die Arbeit der Servicestelle ist das Gesetz über die Dialogische Bürgerbeteiligung.
Wie läuft der Prozess ab?
Es gibt verschiedene Formate der Dialogischen Bürgerbeteiligung wie z.B. Bürgerforen, Runde Tische, Ortsbegehungen und Planungswerkstätten. Wichtig ist, dass die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürgerinnen erfasst werden, nicht nur der konkret Betroffenen.
Hier wird beispielhaft der Ablauf der Zusammenarbeit mit der Servicestelle für ein Bürgerforum zusammengefasst:
1. Vorprüfung: Was sind die Handlungsoptionen?
Vor Beginn wird geprüft, ob echte Handlungsspielräume bestehen und die Politik bereit ist, verschiedene Optionen zu diskutieren. Nur dann macht ein Bürgerdialog Sinn. Ist aus Sicht der Politik die Entscheidung bereits gefallen, besteht nur noch die Möglichkeit, die Öffentlichkeit zu informieren und Transparenz herzustellen.
In der Vorprüfung wird dann geklärt, worüber genau in der Bürgerbeteiligung gesprochen werden soll und wen man wie einbeziehen wird.
Wird mit zufällig ausgewählten Teilnehmenden gearbeitet? Wie werden Stakeholder (z.B. Verbände, Initiativen, Vereine) einbezogen?
2. Beteiligungsscoping: Themen und Akteure
Die nächste Phase nennt sich Beteiligungsscoping. Hier werden Themen- und Akteurslandkarten erstellt. Die Landkarten sind öffentlich zugänglich und können durch Stakeholder und die Öffentlichkeit ergänzt werden.
Hier wird geklärt: Worüber wollen wir konkret sprechen? Haben wir an alle relevanten Akteure gedacht? Es wird Transparenz geschaffen, sowohl über das weitere Vorgehen als auch die inhaltliche Agenda.
3. Organisation des Bürgerforums
Hat man sich für ein Bürgerforum als Beteiligungsform entschieden, dann erfolgt im nächsten Schritt die Auswahl der Zufallsbürger.
4. Umsetzung des Bürgerforums
Ein Bürgerforum umfasst in der Regel vier bis fünf inhaltliche Sitzungen und eine Ergebnisrunde.
- Kennenlernen, Erwartungen an das Verfahren werden geäußert.
- Fachleute, Politik und Stakeholder der verschiedenen Positionen geben Impulse in zwei bis drei Sitzungen. Ziel ist eine möglichst große inhaltliche Bandbreite an Referenten.
- Input wird in ein bis zwei Sitzungen aufgearbeitet und es werden Empfehlungen beraten.
- Die Ergebnisse werden öffentlich vorgestellt.
5. Resonanz-Runde (Antwort der Politik)
Zum vollständigen Beteiligungsprozess gehört schließlich, dass die Adressaten der Empfehlungen, also Gemeinderat, Verwaltung oder Ministerium, sich mit den Bürgervorschlägen auseinandersetzen und öffentlich dazu Stellung nehmen.
Bei der Servicestelle Bürgerbeteiligung sind die einzelnen Schritte ausführlich erläutert und es werden exemplarische Themenlandkarten vorgestellt.
Was kostet die Unterstützung?
Die initiale Beratung und Prozessbegleitung durch die Servicestelle sind grundsätzlich kostenlos. Die Kosten für die Durchführung des Bürgerbeteiligungsverfahrens, also z.B. für externe Moderator*innen, Räumlichkeiten oder Catering, müssen jedoch von der Behörde bzw. vom Vorhabenträger übernommen werden.
Erfahrungsberichte
Die Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung zeigt auf ihrer Webseite Erfahrungsberichte und informiert über laufende sowie abgeschlossene Bürgerbeteiligungsprojekte.
Wie könnt ihr aktiv werden?
Gemeinderät*innen, die mehr Bürgerbeteiligung in ihrer Kommune möchten, können aktiv darauf hinwirken, dass die Servicestelle zum Einsatz kommt.
- Macht eure Verwaltung und den Gemeinderat auf das Angebot der Servicestelle aufmerksam.
- Stellt bei einem geeigneten Vorhaben in eurer Kommune einen Antrag im Gemeinderat, der die Verwaltung zur Durchführung einer Dialogischen Bürgerbeteiligung auffordert. Einen Musterantrag findet ihr in unserem Mitgliederbereich!

Katharina Eckert
Referentin der Geschäftsführung