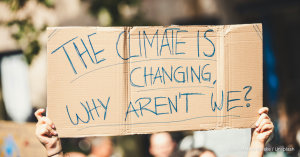Sprache und Kommunikation findet auf unterschiedlichen Wegen statt. Ein direkter Austausch in einer öffentlichen Sitzung gehört ebenso dazu wie eine herabwertende Mimik oder der Beginn von Nebengespräche beim eigenen Redebeitrag. Private Mails mit einschüchternden Nachrichten oder Kommentare auf Internetplattformen vor allem gegen Politikerinnen sind heute gang und gäbe – auch in der Kommunalpolitik.
Ist das schon Hate Speech?
Katrin Schlör hat in ihrem Vortrag deutlich gemacht, dass es unterschiedliche Grade der Verunglimpfung gibt. „Hate Speech“ fängt nicht erst bei Gewaltbildern oder einem Aufruf zu konkreten Taten an. Auch konträre Äußerungen ohne jegliche Begründung oder die Degradierung einer Person gehören sind Formen von Verunglimpfung und damit „Hate Speech“.
Es geht hierbei nicht um eine inhaltliche Debatte. „Hate Speech“ zielt auf die Verunglimpfung einer Person wegen ihrer Identitätsmerkmale wie Geschlecht, Nationalität, Religion, ethnische Zugehörigkeit etc. „Hate Speech“ ist diskriminierend.


Wie funktioniert diese Form der Kommunikation?
„Hate Speech“ dient der Rekrutierung der Symphatisant*innen und Stärkung der In-Group. Sie zielt darauf Aktivist*innen oder andere (Kommunal)Politiker*innen einzuschüchtern. Es geht darum Themen zu setzen und die Deutungshoheit in gesellschaftlichen Diskursen zu gewinnen. Häufig entzündet sich eine „Hate Speech“-Welle an geschlechtergerechter Sprache und Schreibweisen.
Was können wir tun, um uns zu schützen?
Jede und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie man mit herabwertenden Kommentaren umgeht. Wichtig ist dabei im Kopf zu haben: es geht nicht um mich als Person, sondern um mich als (Kommunal)Politiker*in oder politische Aktive*r.
Im Umgang mit Kommentaren ist es ratsam zu unterscheiden zwischen Beiträgen, die strafrechtlich relevant sind und solchen, die der Nettiquette auf der eigenen Seite widersprechen. Erstere sollten per Screenshot gesichert werden. Letztere sollten entweder positiv kommentiert oder gelöscht werden. Eine differenzierte Übersicht von Reaktionsmöglichkeiten hat die Amadeu Antonio Stiftung erarbeitet. Download hier.
Hilfreich ist, nicht in einer Schockstarre zu verharren, sondern sich mit einem schlagfertigen Kommentar oder der Thematisierung in der Sitzung oder im Ältestenrat zu wehren.
Am Ende kann man „Hate Speech“ auch als besondere Form des Lobs interpretieren. Ganz nach Mahatma Gandhi:
„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“
Weitere hilfreiche Stellen und Links:
GAR BW-Mitglieder können auf Nachfrage die komplette Präsentation von Prof. Dr. Katrin Schlör, Evangelische Hochschule Reutlingen, erhalten.