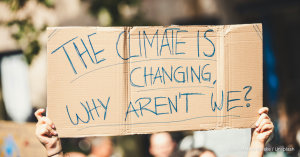Belebtes Grün statt Steinwüsten
Mir gefallen sie nicht gut, die landläufig so genannten Gärten des Grauens. Egal, ob sie mit Kieseln, Schotter oder Granitgestein bedeckt sind. Dass derzeit viel über Steingärten diskutiert wird, finde ich dagegen gut, denn dies offenbart ganz klar, dass es hier längst nicht nur um Fragen des Geschmacks oder der Gestaltung geht. Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Das Grauen lauert in diesen „Gärten“ genannten Außenbereichen, weil sie Insekten und Kleinlebewesen den Garaus machen, weil Blühpflanzen in ihnen nicht gedeihen können, weil sie die Hitzebildung in Sommern wie dem vergangenen befördern und bei Regen Oberflächenwasser schlecht versickern lassen. Kurz: Sie gefährden die Biodiversität in unseren Siedlungsgebieten, und zwar in den Städten und auf dem Land gleichermaßen. Überdies verändern sie das Gesicht bebauter Gebiete. Baukultur, wie wir Grüne sie auf allen Entscheidungsebenen anstreben, hat aber eben auch zum Ziel, Auswirkungen des Klimawandels zu begegnen und neben architektonischen, sozialen, wirtschaftlichen oder kulturellen Aspekten auch ökologische Belange zu berücksichtigen.
All diese Anforderungen hatten wir im Blick, als wir, die Grüne Stadtratsfraktion in Heilbronn, beantragten, dass in Heilbronn eine Satzung erlassen wird, die regelt, dass Freiflächen auch nach ökologischen Kriterien zu gestalten sind. Diesem Anliegen kam unsere Verwaltung nicht nach, weil es dafür keine direkte generelle Satzungsermächtigung im Gesetz gebe, da sich der §74 LBO auf baugestalterische Absichten bezieht. Aber grundsätzlich war zum Glück bei unserer Verwaltung eine große Offenheit für das Thema vorhanden. Nunmehr wird in neuen Bebauungsplänen der Umgang mit Freiflächen eindeutig geregelt.
Grundsätzlich gibt es folgende Vorschriften zum Umgang mit Flächen:
- Der Grundsatzparagraf §1a BauGB schreibt vor, dass das Maß der Bodenversiegelung auf das Notwendige zu begrenzen ist.
- Im Landesrecht sagt der § 9 LBO, dass nicht überbaute Flächen von bebauten Grundstücken Grünflächen sein müssen, sofern sie nicht für eine andere zulässige Nutzung benötigt werden.
Was jetzt aber konkret in Heilbronn zur Anwendung kommt, ist § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB.
Danach können im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen festgelegt werden „die Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“. In unseren Bebauungsplänen heißt es jetzt deshalb:
„Außerdem wird festgesetzt, dass die nicht baulich genutzten Freiflächen der Baugrundstücke auch als unversiegelte Vegetationsflächen gärtnerisch anzulegen sind. Kies-, Schotter und ähnliche Materialschüttungen ggf. in Kombination mit darunterliegenden wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien sind hierfür unzulässig. Teichfolien können nur bei der Anlage von permanent wassergefüllten Gartenteichen zugelassen werden.“
Dies ist ein wichtiger Erfolg um weiterhin lebenswerte Bedingungen in Stadt und Land zu erhalten beziehungsweise zu schaffen. Und zwar für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Wesentlich ist, dass Gemeinderät*innen sensibilisiert sind und die Thematik auf die Agenda bringen. Ich meine damit nicht nur den verwaltungstechnischen Vorgang. Es geht vor allem auch darum, die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, für wirkliche Garten-Alternativen zu gewinnen. Wenn unsere Familien, Nachbar*innen, Freund*innen oder Kolleg*innen lernen, grüne Alternativen zu lieben und wertzuschätzen, werden wir auch in den Räten erreichen, dass unsere Kommunen das Anliegen unterstützen – nicht gegen Steingärten, sondern für die belebte Natur, auch in unserer oft dicht bebauten Umgebung. Ein schönes Beispiel, wie die Akzeptanz dafür steigt, liefern die Gemeinden, in denen mit Hilfe des Programms NaturNahDran Grünflächen im öffentlichen Raum artenschutzgerecht gestaltet werden. Das habe ich in diesem Sommer in meinem Betreuungswahlkreis in Offenau erlebt, wo sich Bauhofmitarbeiter für die Idee begeistern und Fürsprecher für Artenvielfalt geworden sind. Was für ein schönes Vorbild, das Nachahmer*innen im Privaten finden kann. Ich werbe dafür, dass wir Grünen Kommunali über unsere Vorstellung von sinnvoller, der Biodiversität dienlicher Gestaltung von Freiflächen sprechen. Das ist Überzeugungsarbeit im besten Sinne, damit es uns nicht mehr graut vor dem, was alles Garten heißt.
Autorin: Susanne Bay MdL