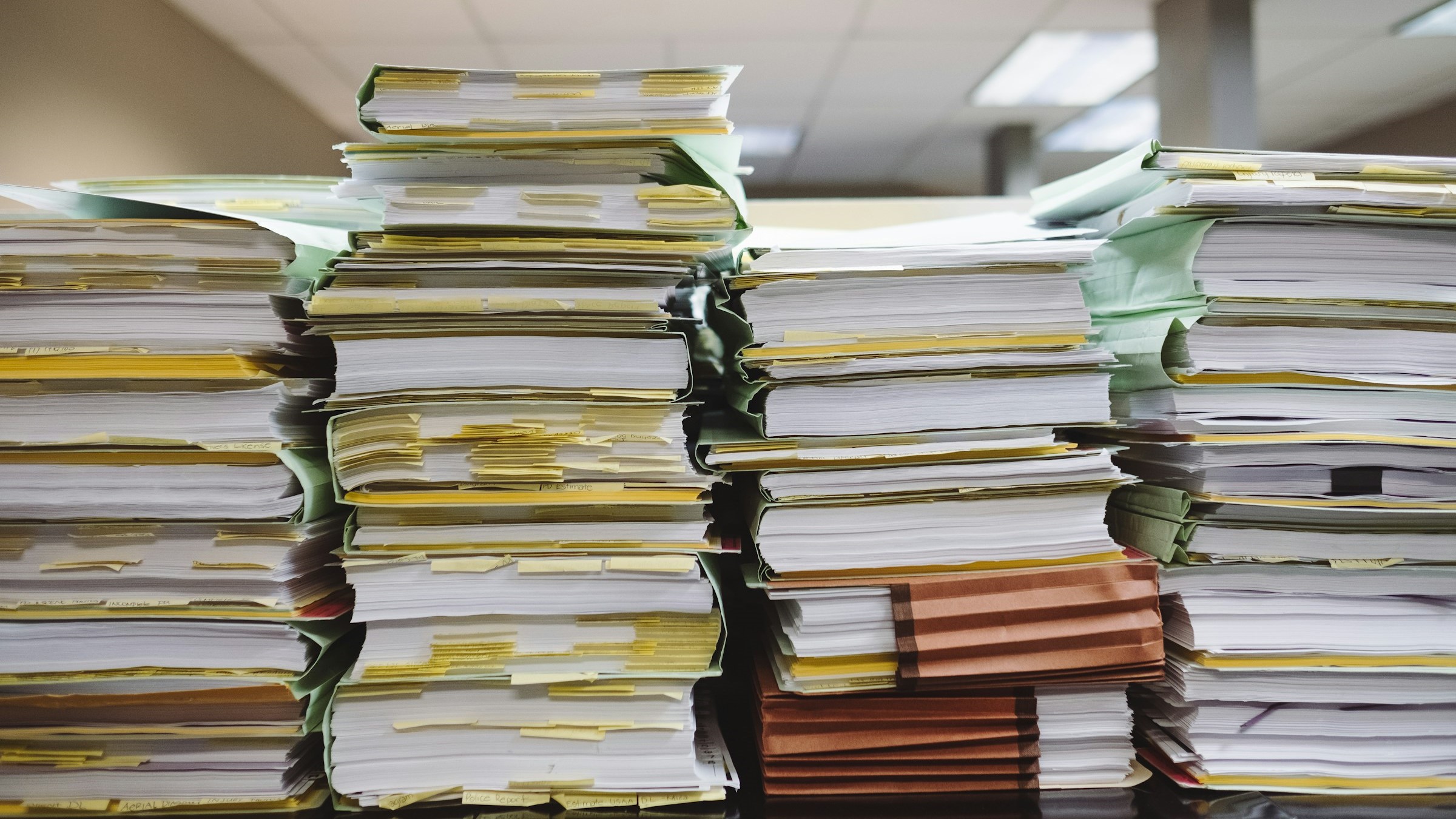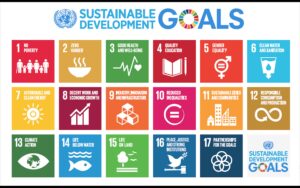Was dürfen Kommunen jetzt tun?
- Abweichungen beantragen: Kommunen können beim zuständigen Ministerium beantragen, von landesrechtlichen Vorschriften abzuweichen, z. B. bei der Landesbauordnung oder Verwaltungsabläufen.
- Neue Lösungswege testen: Sie dürfen alternative Verfahren ausprobieren, etwa bei Kinderbetreuung, Wohnungsbau oder Genehmigungen.
- Eigenverantwortlich handeln: Bürgermeister*innen und Landrät*innen können selbst Anträge stellen. Auch kommunale Landesverbände haben ein Antragsrecht.
- Genehmigungsfiktion: Falls das Ministerium nicht innerhalb von drei Monaten reagiert, gilt der Antrag als genehmigt.
Laufzeit und Bedingungen
- Befristung: Das Gesetz gilt bis 31. Dezember 2030, einzelne Erprobungen sind auf maximal vier Jahre begrenzt.
- Grenzen: Bundesrecht, EU-Recht, Rechte Dritter und das Gemeinwohl dürfen nicht verletzt werden.
Ziel des Gesetzes
- Bürokratieabbau durch praxisnahe Erprobung
- Nutzung kommunaler Sachkompetenz für effizientere Verwaltung
- Vorbereitung auf Herausforderungen wie Fachkräftemangel und demografischer Wandel
Stand Oktober 2025: Gesetz wurde am 08.10.2025 vom Landtag beschlossen.
Die Rolle des Gemeinderats bzw. Kreistags
Nach dem Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetz muss die Bürgermeisterin/der Landrat den Rat/Kreistag über einen gestellten Antrag lediglich unterrichten, nicht aber einen Beschluss einholen.
Jedoch kommt dem kommunalen Gremium spätestens nach der Genehmigung eine entscheidende Rolle zu:
Antrag stellen:
- Der Antrag auf Regelungsbefreiung kann vom Bürgermeister/Landrätin gestellt werden.
- § 24 Absatz 1 Satz 2 der Gemeindeordnung findet bei der Antragstellung keine Anwendung, d. h. es ist kein Beschluss des Gemeinderats erforderlich.
- Der Bürgermeister ist jedoch verpflichtet, den Gemeinderat unverzüglich über die Antragstellung zu informieren. § 3 Abs. 1 KommRegBefrG
- Das Verfahren ist bewusst als niederschwelliges, verwaltungsinternes Verfahren ausgestaltet, um Flexibilität und schnelle Erprobung neuer Verwaltungswege zu ermöglichen.
Genehmigung liegt vor:
Nach der Genehmigung ist der Rat/Kreistag als „Hauptorgan“ gefordert, die versuchsweise Befreiung organisatorisch & rechtlich in der kommunalen Praxis umzusetzen & zu steuern. § 3 Abs. 5 KommRegBefrG
Wichtigste Punkte:
- Satzungs- oder Verfahrensanpassung: z.B. Änderungen kommunaler Satzungen, um das neue Verfahren rechtssicher abzubilden
- Delegationsbeschluss nach § 24 Abs. 1 Satz 2 GemO: d.h. Autorisierung des Bürgermeisters, das erleichterte Verfahren selbständig anzuwenden
- Organisatorische und haushaltsrechtliche Maßnahmen: Freigabe von Personal- oder Sachmitteln für das Pilotprojekt
- Festlegung von Instrumenten für die Evaluierung (Umfragen, Zeitmessung, Kostenanalysen)
Fazit:
Rein formaljuristisch könnte der Rat/Kreistag durch die Ablehnung der „erforderlichen Entscheidungen“ in der Umsetzungsphase das Pilotprojekt vor Ort faktisch zum Erliegen bringen.
Denn die Befreiung durch das Ministerium erzeugt einen Rechtsrahmen, ändert aber keine kommunalen Satzungen oder Haushaltsansätze.
Lehnt der Rat diese Beschlüsse (Satzungsanpassung, Delegation an den Bürgermeister oder die Bereitstellung der Haushaltsmittel) ab, fehlt es an der formellen Rechtsgrundlage (z. B. gebührenrechtliche Basis, Zuständigkeitsregelung, Budget), um das vereinfachte Verfahren tatsächlich anzuwenden.
Planspiele zur Umsetzung des Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetzes
Planspiel zum Personalmangel in Kitas
Die Stadt Sonnenfels hat große Probleme, qualifiziertes Personal für ihre Kindertagesstätten zu finden. Die landesrechtlichen Vorgaben zur Gruppengröße und zum Betreuungsschlüssel sind zwar sinnvoll, aber in Sonnenfels kaum umsetzbar – viele Gruppen drohen zu schließen.
Der Antrag von Bürgermeisterin:
- Ziel: Für zwei Jahre möchte Sonnenfels von der Landesvorgabe zum Betreuungsschlüssel abweichen, um kleinere Gruppen mit weniger Personal betreiben zu dürfen.
- Begründung: Die Kommune hat ein eigenes pädagogisches Konzept entwickelt, das mit weniger Personal auskommt, ohne die Qualität zu gefährden.
- Maßnahmen: Zusätzliche Fortbildungen für das vorhandene Personal, engmaschige Qualitätskontrollen und Elternbeteiligung.
- Erwarteter Effekt: Vermeidung von Gruppenschließungen, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Entlastung für Eltern und Verwaltung.
Rahmenbedingungen:
- Die Abweichung gilt nur für zwei Jahre.
- Es dürfen keine Risiken für Kinder entstehen.
- Das zuständige Ministerium prüft den Antrag – oder er gilt nach drei Monaten automatisch als genehmigt.
Planspiel: Nachhaltiges Schulgebäude
Die Stadt Bildingen möchte ein neues Schulgebäude errichten – nicht nur funktional, sondern als Leuchtturmprojekt für Nachhaltigkeit und Innovation. Im Rahmen des Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetzes beantragt die Stadt eine zeitlich begrenzte Abweichung von bestimmten Vorgaben der Landesbauordnung.
Ausgangslage
- Die Kommune plant eine Grundschule mit Ganztagsangebot, die als Plusenergiegebäude konzipiert ist.
- Ziel ist es, CO₂-neutral zu bauen, regionale Baustoffe zu verwenden und die Schule als Lernort für Nachhaltigkeit zu gestalten.
Abweichungen beantragt bei:
- Dämmvorgaben: Statt synthetischer Dämmstoffe sollen Hanf, Zellulose und Lehm verwendet werden.
- Materialnormen: Einsatz von recycelten Baustoffen aus Rückbauprojekten.
- Technikvorgaben: Integration eines Smart-Building-Systems zur Steuerung von Energie, Licht und Lüftung – nicht in allen Regelwerken vorgesehen.
Begründung:
- Die geplanten Maßnahmen erfüllen die Anforderungen an Brandschutz, Statik und Barrierefreiheit.
- Die Schule wird als Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet, u. a. durch eine Hochschule für nachhaltige Architektur.
Planspiel zur Digitalisierung: Virtuelles Bauamt beschleunigen
Der Antrag:
- Ziel: Für ein Jahr soll die Stadt digitale Baugenehmigungen ohne Papierformulare vollständig durchführen dürfen – auch bei komplexen Vorhaben.
- Begründung: Die Verwaltung ist technisch und personell vorbereitet, die Bürger*innen sind digitalaffin.
- Maßnahmen: Schulungen für Mitarbeitende, digitale Beteiligung von Nachbarn, elektronische Bekanntgabe der Entscheidungen.
- Besonderheit: Auch die Beteiligung anderer Behörden erfolgt über ein gemeinsames digitales Vorgangsraum-System.
Effekt:
- Weniger Medienbrüche
- Schnellere Bearbeitung
Planspiel: Neubaugebiet ohne Umweltprüfung
Die Gemeinde will ein Neubaugebiet ausweisen und dabei die Umweltprüfung stark vereinfachen oder ganz umgehen. Doch hier stößt das Kommunale Regelungsbefreiungsgesetz (KommRegBefrG) an klare Grenzen.
Was nicht geht:
- Umweltprüfungen sind bundes- und EU-rechtlich vorgeschrieben, z. B. nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) und der Strategischen Umweltprüfung (SUP).
- Das Regelungsbefreiungsgesetz erlaubt nur Abweichungen von landesrechtlichen Vorschriften – nicht von Bundesrecht oder EU-Recht.
- Eine Befreiung von der Umweltprüfung wäre rechtswidrig, wenn sie gegen diese höherrangigen Vorgaben verstößt.
Was möglich wäre:
- Die Gemeinde könnte beantragen, Verfahrensschritte innerhalb der Landesbauordnung zu vereinfachen, z. B. bei der Beteiligung oder Fristen.
- Sie könnte ein Pilotprojekt zur digitalen Umweltprüfung starten – etwa mit KI-gestützter Auswertung oder vereinfachten Beteiligungsformaten.
- Auch eine räumliche Eingrenzung des Projekts (z. B. nur innerörtliche Nachverdichtung) könnte helfen, die Prüfungspflicht zu reduzieren – aber nicht aufheben.
Fazit hier:
Das Regelungsbefreiungsgesetz ist kein Freifahrtschein, um Umweltprüfungen zu umgehen. Es bietet Spielraum für Innovation, aber nicht für Rechtsverstöße.