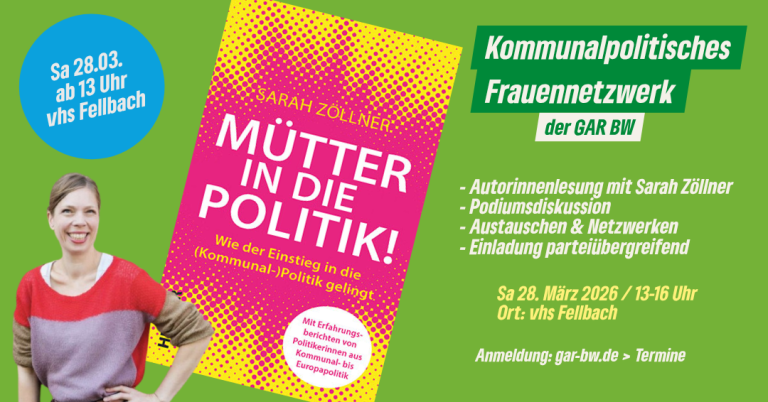Um das im Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegte Ziel die Erderwärmung auf 1,5 Grad bis 2040 zu begrenzen, sind enorme Kraftanstrengungen vor Ort notwendig. Immer mehr Städte und Landkreise machen mit dem Ausruf eines „Klimanotstand“ oder eines „Klimavorbehalts“ auf die Dringlichkeit des kommunalen Klimaschutzes aufmerksam.
Die Besetzung neuer Stellen, das Aufsetzen von Förderprogrammen, zusätzliche finanzielle Mittel für die Energieagenturen, das Einleiten von Ausgleichsmaßnahmen oder die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude sind zusätzliche Kosten, die auf die öffentliche Hand zukommen. Allerdings werden die Kosten, die durch die Klimakrise entstehen, wie beispielsweise Schäden durch extreme Hochwasser und Stürme oder Einbußen in der Nahrungsmittelproduktion durch Trockenheit, die Kosten einer konsequenten CO2-Minderungsstrategie bei weitem übersteigen.
Die Verabschiedung eines Klimavorbehalts dient in einem ersten wichtigen Schritt der Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden, um bei jedem Verwaltungshandeln mögliche Konsequenzen für das Klima zu berücksichtigen.
Auf der Internetseite des Klima-Bündnis sind weitere Informationen und Praxisbeispiele aufgelistet. Mehr dazu hier.
Die Kreistage in Böblingen, Ravensburg und Tübingen haben sich beispielsweise mit dem Thema bereits befasst.
Klimaschutz im Landkreis Böblingen: Vorlage KT-Drucks. Nr. 100/2021/1
Grüne Kreistagsfraktion Ravensburg: Antrag Klimavorbehalt
Grüne Kreistagsfraktion Tübingen: Antrag Klimavorbehalt