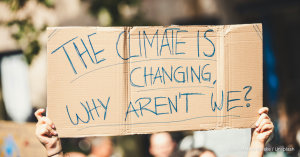von Thomas Tuschhoff (KV Main-Tauber, Stadtrat in Bad Mergentheim)
Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim vom 19. Juli 2022 zur Gemeinderatswahl 2019 in Tauberbischofsheim betrifft potentiell alle Kommunen im Land, die auch 50 Jahre nach der Gemeindereform an der unechten Teilortswahl festhalten. Weil die Teilorte im Gemeinderat von Tauberbischofsheim zu ungerecht repräsentiert sind, muss die Wahl am 5. Februar 2023 wiederholt werden.
Abweichungen der Repräsentation von Ortsteilen im Gemeinderat sind von der bisherigen Rechtsprechung sehr großzügig erlaubt worden. 20 %ige Über- oder Unterrepräsentationen sah das Innenministerium als zulässig an. Auch größere Abweichungen seien möglich, wenn dies mit den besonderen örtlichen Verhältnissen zu begründen ist. Das Urteil zu Tauberbischofsheim legt nun strengere Maßstäbe an. Die Regelungen der Eingemeindungsverträge, die den Teilorten feste Sitze garantierten, gelten nicht mehr uneingeschränkt. Vielmehr sind die Veränderungen der Einwohnerzahlen zu berücksichtigen und eine möglichst gerechte Sitzverteilung vorzunehmen. Alle Kommunen mit unechter Teilortswahl müssen sich nun die Frage stellen, ob ihre Verteilung der Gemeinderatssitze auf die Teilorte bzw. Wohnbezirke den Kriterien dieses Gerichtsurteils entspricht. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die nächste Gemeinderatswahl erfolgreich vor Gericht angefochten wird.
Probleme der unechten Teilortswahl
Fünfzig Jahre nach der Gemeindereform kann man die Ansicht vertreten, dass die Gemeinden in dieser Zeit so stark zusammengewachsen sind, dass die unechte Teilortswahl nicht mehr gebraucht wird. Viele Gemeinden haben sich deswegen schon von ihr verabschiedet. Dennoch halten mehrere hundert Gemeinden an der unechten Teilortswahl fest. Mit dem komplizierten Wahlverfahren sind viele Bürger:innen überfordert. Es kommt zu ungefähr doppelt so vielen ungültigen Stimmabgaben wie ohne unechte Teilortswahl. Zudem werden die Gemeinderäte durch Ausgleichsmandate über die vorgesehene Anzahl von Sitzen hinaus vergrößert.
Handlungsmöglichkeiten der Kommunen
Das VGH-Urteil hat die Kommunalverwaltungen im ganzen Land aufgeschreckt. Sie werden sich mit der Unterstützung von Städtetag und Gemeindetag bemühen, rechtskonforme Lösungen zu finden. Es ist aber keineswegs sicher, dass die Verwaltungen ihren Gemeinderäten die jeweils fairste Lösung vorschlagen werden. Es ist möglich, dass sie auf lokale Partikularinteressen Rücksicht nehmen und zwar eine vermeintlich rechtssichere, aber nicht unbedingt die gerechteste Lösung einbringen. Daher sollten grüne und grünnahe Gemeinderät:innen alle Möglichkeiten kennen, um im Zweifelsfall Änderungsanträge stellen zu können.
1. Unechte Teilortswahl abschaffen
Mit einer Änderung der Hauptsatzung können die Gemeinden die unechte Teilortswahl abschaffen. Das ist die sicherste Methode, eine Wahlanfechtung zu vermeiden. Dafür braucht es eine qualifizierte Mehrheit im Rat, d.h. die Mehrheit der Gemeinderäte, nicht nur die Mehrheit der Anwesenden. Dabei muss man mit Widerstand gegen eine solche Satzungsänderung rechnen. Weil manche Mandatsträger:innen den Verlust ihres Sitzes fürchten wehren sie sich dagegen. Auch die Listen, die von der unechten Teilortswahl profitieren, werden der Abschaffung kaum zustimmen. Vor einem Antrag die unechte Teilortswahl abzuschaffen sollte man daher Gespräche mit anderen Fraktionen führen um zu klären, ob dafür eine qualifizierte Mehrheit zu erwarten ist.
2. Sitzverteilung optimieren
Sollte sich keine qualifizierte Mehrheit dafür abzeichnen die unechte Teilortswahl abzuschaffen, sollte man zumindest eine möglichst gerechte Verteilung der Gemeinderatssitze auf die Teilorte bzw. Wohnbezirke anstreben. Das erwähnte Urteil des VGH in Mannheim liefert dafür viel Rückenwind. Um eine möglichst faire Sitzverteilung zu finden ist allerdings etwas Rechenarbeit nötig. Mit unten beigefügte Exel-Datei kann diese Berechnung beispielhaft vorgenommen wird. Diese Tabelle muss auf die örtlichen Verhältnisse anpasst werden.
Zum besseren Verständnis des Verfahrens, wird diese nachfolgend beschreiben:
Mögliche Szenarien beim Berechnungsverfahren:
Um die bestmögliche Sitzverteilung auf die Teilorte bzw. Wohnbezirke zu finden rechnet man die Sitzverteilung mit allen möglichen Sitzzahlen durch und achtet darauf, bei welcher die prozentualen Abweichungen am geringsten ausfallen. Bei unechter Teilortswahl erlaubt § 25 der Gemeindeordnung nämlich, dass in der Hauptsatzung mehr oder weniger Sitze festgesetzt werden können, als für die Größenklasse der Gemeinde vorgesehen sind. Zulässig sind alle Sitzzahlen zwischen der nächst niedrigeren und der nächst höheren Gemeindegrößenklasse.
Wenn in der Hauptsatzung jedem einzelnen Teilort Sitze zugeteilt sind, und es in allen Szenarien bei starken prozentualen Abweichungen bleibt, kann man versuchen, mehrere Teilorte zu einem Wohnbezirk zusammenzufassen und prüfen, ob sich dadurch geringere Abweichungen ergeben. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Teilorte nicht beliebig zusammengefasst werden dürfen. Die Teilorte eines Wohnbezirks müssen aneinander grenzen.
Im zweiten Tabellenblatt der Excel-Tabelle wurden die Teilorte der Gemeinde aus dem ersten Tabellenblatt, die bisher jedem Teilort jeweils einen Sitz garantierte, zu Wohnbezirken zusammengefasst. Der Vergleich der prozentualen Abweichungen im ersten und zweiten Tabellenblatt zeigt, dass die maximale prozentuale Abweichung auf diese Weise von 54% auf 8% reduziert werden könnte. Bei Gemeinden, die bereits mit Wohnbezirken arbeiten, die aus mehreren Teilorten bestehen, kann sich eine gerechtere Verteilung eventuell auch dadurch ergeben, dass man einen Teilort aus einem Wohnbezirk in einen anderen verschiebt.
Wird die bestmögliche Sitzverteilung nicht bereits von der Verwaltung vorgeschlagen oder vermeidet sie es gar, sich überhaupt damit zu befassen, sollte man den Antrag stellen, die Hauptsatzung zu ändern und die beste Sitzzahl und Sitzverteilung festschreiben. Dieser Antrag muss rechtzeitig vor Beginn der Frist für die Listenaufstellung gestellt werden. Wenn diese Frist schon angelaufen ist und erste Aufstellungsversammlungen bereits stattgefunden haben oder hätten stattfinden können, ist eine Änderung der Sitzverteilung in der Hauptsatzung nicht mehr möglich. Auch für diese Satzungsänderung ist die qualifizierte Mehrheit nötig. Das Abwenden einer erfolgreichen Wahlanfechtung sollte aber ein überzeugendes Argument sein.
Autor: Thomas Tuschhoff | Tel.: 07931 / 8438 | E-Mail: tuschhoff (at) gruene-mgh.de